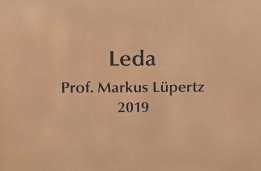Am Rhein steht seit 2019 ein
|
 |
|
Glosse
Wie schön,
dass man in einem demokratischen
Land lebt, da darf man nicht nur denken,
da darf man sogar auch laut sprechen. Oder?
Also,
ich hab’s endlich gesehen. Sie fragen nun, was denn?
Ja, das da …, was da nun am Rhein steht. Ehe ich jetzt
alles aus den Zeitungen zitiere, will ich mal alles total
vergessen, z.B. dass Herr Lüpertz ein renommierter
Künstler ist und dass das Ding da, das die Nachfol-
gerin vom Gänseliesel ist, 700.000 Euro gekostet hat.
Jetzt bin ich frei von Vorurteilen und fähig, unbe-
fangen ans Objekt zu gehen. Also, ich sehe erst
mal einen Rohbau. Dann kommen mir die Beine so
bekannt vor. Habe ich nicht mal vor Jahren an
der alten Neandertalerfigur solche gesehen?
Nach dem ersten Eindruck pirsche ich mich nun
Stück für Stück nach oben. Ich finde, das Mini-
hemdchen ist viel zu kurz, um gegen die rauen
Winde am Rhein Schutz zu bieten. Nun erkenne
ich auch an den buckeligen Körperteilen, inklusive
brustähnlichen Gebilden, dass es sich hier wohl
um eine Dame handelt, die gern Bodybuilding macht.
Was gut zu den Beinen passt, ist der breite Hals,
der enorm nach vergrößerter Schilddrüse aussieht.
Nun bin ich zehn Meter hoch beim groben Gesicht
mit dem seelenvollen gen Himmel gerichteten Blick
angelangt. Und dann ist da noch etwas: ein liebens-
wertes federviehähnliches Teil, das gern an ihrem
Gesicht knabbern würde, was sie aber nicht will.
Das also ist das neue Wahrzeichen von Monheim
am Rhein. Honi soit qui mal y pense!
7. November 2019
Als die Erde seufzte
Fabel von Ingrid Knebel
Sie schleppten sich zum Versammlungsplatz, wobei einer den anderen stützte.
„Als wir das letzte Mal zusammenkamen...“, sinnierte das Wasser, „...mein Gott, was waren wir da noch lustig“, fiel die Erde ein.
„Ich glaube“, bemerkte die Luft mit schmerzlichem Lächeln, „wir sind alt geworden.“
„Ich fühle mich genauso schlecht wie ihr“, knurrte das Tier, „und dabei bin ich noch so jung.“
„Ich meine“, sagte zögernd die Erde, „wir sollten etwas tun!“
„Wir müssen an die Wurzel des Übels“, bekräftigte die Pflanze.
„Der, der zuletzt gekommen ist, auf den könnten wir am ehesten verzichten“, philosophierte die Luft.
Das Wasser brodelte. Es schien sich innerlich schrecklich aufzuregen. Und ehe noch jemand etwas sagen konnte, mußte es furchtbar aufstoßen. „Und immer dieser chemische Geschmack im Mund“, sagte es angewidert. Mitleidig blickten sie zum Wasser.
Da schlug die Pflanze die Blätter zurück, und alle sahen, daß sie über und über mit Pestizid-Beulen bedeckt war. Als die Erde schweigend einen Blick in ihr Inneres offenbarte, erschraken sie sehr. Auch schien ihnen jetzt erst aufzufallen, daß die Luft ganz grau im Gesicht war.
„Es steht schlimmer um uns, als wir dachten“, sagte das Wasser ernst. „Was könnten wir tun?“
„Erst müssen wir das Übel beim Namen nennen“, seufzte die Erde.
„Es ist der Mensch“, riefen alle wie aus einem Munde.
„Wir sollten auf ihn verzichten!“, forderte das Wasser. Alle nickten.
„Sollen wir ihn ganz abschaffen, oder sollen wir ihm nur einen Denkzettel verpassen?“, fragte das Tier, das plötzlich eine unerklärliche Sympathie für den Menschen zu entwickeln schien.
„Wir alle“, erklärte die Luft, „wir sind wie eins. Wir respektieren einander. Nur – dieser Mensch! Er paßt nicht zu uns.“
„Wo kommt er eigentlich her?“, fragte das Wasser aufgebracht. "Er hat keinen Respekt vor uns.“
„Wir wissen nicht, was mit ihm los ist und wozu er nutze ist“, resümierte das Tier. „Vielleicht sollten wir es erst einmal mit einem Denkzettel versuchen?“ Die Stimme des Tieres klang bittend.
„Ich rufe alle Freunde zusammen, dann ist es aus mit ihm“, sagte das Wasser ungerührt. „Das ist gut“, stimmte die Erde müde zu.
„Nein, nein!“, riefen Pflanze und Tier, „allzuviel Wasser können wir nicht vertragen. "Wie wär′s denn, wenn ich alle Freunde zusammenriefe“, sagte die Pflanze, „und wir alles verdorren ließen?“
„Das ist gut“, sagten Luft, Wasser und Erde gleichzeitig. Nur das Tier sagte kleinlaut: „Dann hätte ich nichts mehr zu essen.“
„Wir dürfen dem Tier nicht schaden, wenn wir den Menschen strafen wollen“, rief die Luft. „Ich glaube, ich hab′s, mir ist sowieso ziemlich schlecht. Ich spanne mal aus und schalte ab.“ Erschöpft hielt sie inne.
Der Vorschlag der Luft war gut. Er war ohne viel Aufwand praktikabel. Einzig dem Tier war etwas mulmig. Deshalb kamen sie überein, die Luft nur über Atomkraftwerken und allen umweltbedrohenden Einrichtungen kurz abzuschalten.
*
„Das mit dem Denkzettel war gut“, lachte das Wasser und schlug dem Tier fröhlich auf die Schulter.
„Und als sie wieder zu sich kamen, wußten sie nichts mehr anzufangen mit ihren Atomkraftwerken und all dem hochintelligenten technischen Schnickschnack“, kicherte die Luft, die richtig appetitlich aussah.
„Warum bist du so ernst, Erde?“, fragte die Pflanze.
„Nach Menschenzeit sind seit unserem letzten Treffen dreißig Jahre vergangen. Ja, es ist besser für alle geworden. Sie respektieren uns endlich wieder.“
Immer noch litt die Erde unter unsäglichem Bauchweh, das von den Chemikalien kam, die tief in ihrem Inneren wüteten.
„Aber“, sagte die Erde bedeutsam, „wenn sie wieder so anfangen...“,
„...dann zwingen sie uns zu ihrer Abschaffung!“, vollendeten mit gespieltem Bedauern Wasser, Luft, Pflanze und Tier. (STOPpelfeld 2, Juni 1987)
Dann lag er neben ihr im Gras
Erzählung von Ingrid Knebel
Er verharrte mitten in der Bewegung. Es war nur ein ganz kleines unbekanntes Geräusch gewesen, doch alle Alarmglocken läuteten in seinem Kopf.
Er drehte seine Ohren in alle Richtungen, doch es blieb still. Er wußte aus Erfahrung, daß sie manchmal sehr raffiniert waren. Einige von ihnen stampften zwar plump durchs Gehölz, daß es ihn fast amüsierte, wieviel Krach sie machten und er sich schon lange, bevor sie auch nur etwas von ihm ahnen oder auch nur einen Zipfel seines roten Rockes sehen konnten, in Sicherheit brachte.
Plötzlich hatte er das Gefühl, daß die Gefahr näher war als er für möglich gehalten hätte. Was hatte ihn denn so abgelenkt, daß er jetzt erst aufmerksam geworden war?
Er wußte, es war die Füchsin, hinter der er her war. Zweimal hatte er schon einen Konkurrenten abwehren müssen. Er wäre jetzt viel lieber in ihrer Nähe und würde sie beobachten und ihr seine Zuneigung zeigen und hoffen, daß sie seine Werbung annehmen würde.
Doch er stand hier untätig und mußte warten, was er vorhatte zu tun. Er spürte mit allen Fasern, daß wieder einer dieser aufrechten Zweibeiner in der Nähe war. Er vermutete, daß es der war, der sich seit Tagen an seine Spur geheftet hatte und ihm alle Freude am Leben nahm. Gerade jetzt, wo die schönste Zeit war, die Ranz, wollte er ihn zur Strecke bringen. Zweimal schon hatte er Auge in Auge mit ihm gestanden, doch jedesmal konnte er sich mit einem verzweifelten Sprung vor den tödlichen Kugeln retten.
Er hatte in seinem Leben schon öfter einem Jäger in die Augen gesehen und manchmal eine Mordgier entdeckt, die ihn erschreckte. Dieser hier war anders. Er hatte lustige Augen und lachte, wenn er daneben geschossen hatte. Aber der Fuchs wußte, er war zwar nicht so verbissen, doch er hatte auch nur ein Ziel...
Da war es wieder, dieses winzige Geräusch. Es irritierte ihn, daß er nicht genau ausmachen konnte, woher es kam. Doch er würde warten. Wenn der Jäger die Nerven verliert, passiert nichts, doch wenn ich die Nerven verliere und wegrenne, bin ich tot, dachte er. Das Bild der schönen Füchsin kam ihm in den Sinn, und er läge jetzt gerne neben ihr im Gras und würde zärtlich ihr Gesicht lecken und an Hals und Wangen knabbern.
Er hörte plötzlich ein zweites Geräusch aus einer anderen Richtung. Der Gedanke, daß zwei Jäger in der Nähe sein könnten, entsetzte ihn. Ob sie ihn heute zur Strecke bringen würden? Er gönnte seinem Nebenbuhler nicht die schöne Füchsin. Er würde um sein Leben kämpfen. Vielleicht hatte er noch einmal Glück und konnte die Ranz mit all ihren Höhepunkten erleben.
Er wußte, er mußte jetzt kühl und fehlerlos planen, wenn er lebend hier herauskommen wollte. Er prüfte noch einmal, von wo die zwei Geräusche gekommen waren und berechnete, in welchem Winkel er die meisten Chancen für einen erfolgreichen Durchbruch hatte. Der Gedanke an die Füchsin stärkte seinen Überlebenswillen. Ihm blieben nicht viele Möglichkeiten. Auf der einen Seite war offenes Gelände, und das winterliche Gras würde ihm keinerlei Deckung bieten. Er mußte zwischen den zwei Geräuschen seinen Ausfall wagen. Wenn er Glück hatte, würden sich dann die zwei Jäger vielleicht selbst zur Strecke bringen. Er lachte in sich hinein, doch gleichzeitig wußte er, daß sie, was ihr eigenes Leben anging, sehr vorsichtig und empfindlich waren.
Er zögerte noch etwas. Der Gedanke an die Füchsin beflügelte ihn. Er rannte los. Mit dem Knall spürte er gleichzeitig einen schweren Schlag an seiner Flanke. Er fiel auf die Seite und konnte sich nicht mehr bewegen. Ob die schöne Füchsin ihn vermissen würde?
Plötzlich brach es krachend aus dem Unterholz hervor. Der Jäger stand vor ihm. Seine lustigen Augen schauten jetzt mitleidig.
Heuchler, dachte der Fuchs, du bist mit deinem Donnerstock ein viel gemeineres Raubtier als ich es je in meinem ganzen Leben gewesen bin. Ich habe nur getötet, wenn ich Hunger hatte...
Mit letzter Kraft legte er schützend eine Pfote vor seine Augen. Dann lag er neben der Füchsin im Gras ... (STOPpelfeld 16, März 1997)
Der letzte Schrei
Glosse von Ingrid Knebel
Adam und Eva waren ein modernes Paar, das nach dem letzten Schrei lebte. Sie waren kinderlos. Wenn man ehrlich war, wie hätten sie auch Zeit für solch einen Luxus finden sollen?
Er fuhr einen schnittigen Sportwagen, sie Geländewagen. Zusammen gingen sie mit Arbeitskollegen Kegeln, einmal die Woche zum Bodybuilding, dienstags zum Tennis, irgendwann so zwischendurch mal zur Sonnenbank und jeden Freitag im Umkreis von 60 Kilometern mit Freunden essen. Samstags morgens fuhren sie zum 28 Kilometer entfernten Supermarkt einkaufen, und nachmittags war bei ihr Körperpflege mit allem Drum und Dran und bei ihm Squash angesagt. Abends gingen sie dann ganz groß aus.
Gar nicht zu rechnen all die Geburtstage und sonstigen Festivitäten. Alle vier Wochen schauten sie mal nach den alten Leutchen, die ihre Eltern waren und sagten kurz
Hallöchen.
Sie waren immer nach dem letzten Schrei gekleidet und gaben vierteljährlich einen Kleidersack zum Roten Kreuz. Sie hatten eine Raumpflegerin und einen Fensterputzer. Der Dekorateur hatte gerade die gewaschenen Gardinen wieder angebracht. Sonntags blieben sie eisern zu Hause. Sie schliefen bis mittags, machten sich eine Dose Fertigsuppe auf oder holten ein Tiefkühlmenü für die Mikrowelle aus dem Gefrierschrank. Sonntags gingen sie früh schlafen. Sie hatten schließlich wieder eine harte Woche vor sich.
Wenn es an die Urlaubsplanung ging, bekamen sie meistens Krach. Er wäre am liebsten mit seinem Wagen in die Ferien gefahren und sie mit ihrem Geländewagen. Sie entschlossen sich dann aber der Umwelt – ihrer Umwelt – zuliebe fürs Flugzeug. Er hatte am Arbeitsplatz eine Weltkarte aufgehängt und die kleine polynesische Insel übergroß umrandet, wo sie dieses Jahr hinfahren wollten. Er genoß die neidischen Blicke seiner Kollegen und sonnte sich in der Bewunderung derer, die sich nicht genug darüber aufhalten konnten, daß er ein so ungewöhnliches Ziel ausgemacht hatte. Die kleine Insel hatte einen Flugplatz und ein Hotel mit Swimmingpool. Das war alles, was sie brauchten. Natürlich mußte abends die Animation stimmen, aber das war ja wohl durch den Preis abgeklärt.
Als sie zurückkamen, brauchte niemand aus ihrer Clique zu fragen, wie es gewesen war. Man sah es. Sie waren schwarzbraun, was hieß, daß der Urlaub nicht besser hätte sein können.
Obwohl sie mit anderem so beschäftigt waren, hörten sie einmal etwas von schlechtem Trinkwasser. Sofort zogen sie ihre Konsequenzen. Sie tranken fortan keinen Whiskey on the rocks mehr. Zum mehrmaligen Duschen täglich und für die Toilette war das Wasser gut genug. Sie brauchten kein besseres. Sie kochten ja kaum.
Solange die Preise auf den Tafeln an den Tankstellen konstant blieben, bestand wahrlich kein Anlaß zur Aufregung. Auf der Autobahn pflegten sie alles aus dem Sportwagen herauszuholen, was in ihm steckte. Sie hielten die grünangestrichenen Randstreifen für Natur. Über die Gerippe der Bäume konnten sie sich nicht genug amüsieren.
Eines Tages, als Eva aus dem Wagen stieg, schnappte sie krampfhaft nach Luft und fiel um. Sie hörte schon nicht mehr Adams letzten Schrei. (STOPpelfeld 9, November 1991)
Betrachtungen einer Stubenfliege
Von Ingrid Knebel
Puh, war das knapp. Da schlägt diese Frau doch so plötzlich zu, dass ich mich nur mit Müh' und Not retten kann. Normalerweise erkenne ich schon im Voraus, wenn irgendwelche Attacken gegen mich geplant sind. Das kommt daher, dass ich mir Zeit nehme, die Menschen zu beobachten. Das ist so gut wie eine halbe Lebensversicherung. Gott sei Dank sind meine Reflexe noch bestens. Ich weiß allerdings nicht, wie lange ich noch fit bin bei der schmalen Kost hier. Auf jeden Fall muss ich mich nach diesem gemeinen Angriff erst mal putzen. Ich vermute, das ist bei mir so eine Art, Stress abzubauen.
Ich hätte doch wirklich gedacht, dass ich das lästige Vieh endlich gekriegt hätte. Doch was ist? Es sitzt frech da und putzt sich. Und noch dazu an so einer Stelle in der Küche, wo ich keine Möglichkeit habe, es zu erwischen.
Gestern hat diese Frau meine Freundin erschlagen. Ich habe ihr ständig eingebläut, vorsichtig zu sein. Doch was macht sie? Sie nippt an dem Schweinebraten. Ich habe direkt gesehen, dass die Frau das sehr übel genommen hat und nur auf eine günstige Gelegenheit wartet, ihr das heimzuzahlen. Dass meine Freundin an dem Fleisch genippt hat, ist kein Wunder. In dieser Küche verhungert man fast. Jeder Krümel wird weggewischt, und der Mann spült immer direkt nach dem Essen das Geschirr ab. Das ist absolut das Gemeinste, was ich bisher erlebt habe. Eine ganze Generation Fliegen könnte satt werden nur von dem, was noch auf ihren leeren Tellern ist.
Ich scheuche diese Fliege mal auf. Vielleicht lässt sie sich dann irgendwo nieder, wo ich sie besser kriegen kann.
Die Frau ist hinter mir her, wie der Teufel hinter der armen Seele. Ich brauche jetzt unbedingt ein bisschen Ruhe, um nachdenken zu können. Ich fliege mal ein paar blitzschnelle Runden durch die Küche und verschwinde dann unter einem Blumenblatt am Fenster.
So ein raffiniertes Luder! Die ist so schnell geflogen, dass ich nicht gesehen habe, wo sie sich hingesetzt hat. Na! Irgendwann werde ich sie schon kriegen.
Seit meine Freundin tot ist, bin ich nur noch deprimiert. Auf einmal muss ich immer an früher denken. Mir kommen all die Wohnungen, wo ich vorher war, wie das reinste Schlaraffenland vor. Nunja, die mit den vielen Kindern war schon recht stressig. Aber was gab es da zu futtern! Irgendeiner hat immer gekleckert oder gekrümelt. Doch die Blagen haben so einen Krach gemacht, dass mir das regelrecht auf die Ohren geschlagen ist und ich nur noch an Flucht denken konnte. Als ich dann die offene Balkontür entdeckte, habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, und ab ging die Post. Draußen bin ich allerdings wie falsch’ Geld rumgeflogen. Schließlich bin ich eine Stubenfliege und musste mich beeilen, dass ich noch vor Einbruch der Dunkelheit ein Quartier finde. Ich hatte wirklich Glück und nahm Unterschlupf bei einem alten Ehepaar. Die fühlten sich zwar durch mich ziemlich gestört, doch stellten sie keine Gefahr dar. Wenn einer nach mir schlug, da war ich schon zehnmal weg. Die ließen oft das Geschirr stehen, um schnell erst einen Mittagsschlaf zu machen. Dann konnte ich mich nach Herzenslust satt essen. Eigentlich, wenn ich so die Vergangenheit Revue passieren lasse, war ich dort am glücklichsten. Und dann passierte mir dieser folgenschwere Irrtum. Ich dachte, ich fliege durch die Tür in das andere Zimmer, in Wirklichkeit war es das sperrangelweit geöffnete Fenster. Als ich meinen Schnitzer bemerkte, war es schon zu spät. Die hatten das Fenster ganz schnell wieder zugemacht.
Gerade ist die Frau rausgegangen, dafür sitzt jetzt der Mann am Tisch und liest Zeitung. Hach, das ist toll. Der merkt das gar nicht, wenn ich auf seinen Arm fliege. Obwohl er ziemlich viele Haare dort hat, schaffe ich es doch, an seiner Haut zu nippen. Die ist so herrlich salzig. Ich schwärme davon genauso wie diese fiese Frau von ihrem Kuchen mit Sahne. Wenn man an den Teufel denkt, dann kommt er schon. Szzzzz.
- Was ist los? Warum haust du mich denn?
- Da hat diese Fliege bei dir auf dem Arm gesessen.
- Ach, lass sie doch. Die tut doch nichts.
Der Mann ist wirklich nett. Die Frau ist dumm. Ich kann ja verstehen, wenn sie die ekligen grünen Fliegen mit dem Staubsauger wegfängt, doch soll sie mich bitte endlich in Ruhe lassen. Ich esse an keinem Kothaufen und bin auch sonst überaus reinlich. Zu trinken habe ich zwar genug, weil in den Untersetzern der Pflanzen oft Wasser steht, doch der Magen knurrt mir, dass es schon nicht mehr feierlich ist.
- Magst du gleich auch etwas von der Quarkspeise, Walter?
- Ja, aber nur, wenn sie nicht so kalt ist.
- Ich hole sie schnell schon mal aus dem Kühlschrank.
Jetzt sind beide rausgegangen, und der Quark steht da. Die Frau hat vergessen, ihn abzudecken. Ich sterbe fast vor Hunger. Sieht ja ganz gut aus, werde mal ein bisschen dran nippen. Verflixt, ist der aber weich. Hilfe! Ich sinke mit den Beinen ein. Und die Frau kreischt ohrenbetäubend.
- Walter, komm mal schnell, die Fliege sitzt in dem Quark!
Ach, werte Frau, von Sitzen kann doch gar keine Rede sein. Ich gehe unter! Von Ihnen ist gewiss keine Hilfe für mich zu erwarten. Auch werden Sie schon zu verhindern wissen, dass Walter mich rettet. Meine Freundin ist tot und mein letztes Stündlein hat wohl nun geschlagen. Schade ist nur, dass ich von dieser interessanten Welt Abschied nehmen muss mit Ihrem Kreischen in den Ohren.
- Walter, nun komm doch endlich. Die Fliege ist im Quark verschwunden...
6. Juni 2004
Wehe, wenn ...
Glosse von Ingrid Knebel
Was war's doch gleich, was ich erzählen wollte? Ach ja! Neulich also, da treffe ich nach langer Zeit mal wieder Frau Wagenknecht.
„Wie geht's Ihnen denn so, Frau Wagenknecht?“, rufe ich munter.
„Recht gut. Nur...“, zögert Frau Wagenknecht, „ich mach' mir Sorgen.“
„Ja?“, sage ich mitfühlend und etwas erwartungsvoll.
„Mein Mann fährt zum Wintersport.“
„Allein?“, frage ich verwundert.
„Natürlich nicht allein!“, belehrt mich Frau Wagenknecht empört. „Mit einem Freund!“
„Achso“, bemerke ich intelligent.
„Hoffentlich schneit es nicht!“, sagt Frau Wagenknecht inbrünstig.
„Wie bitte? Sagten Sie nicht eben, Ihr Mann wolle zum Wintersport?“, frage ich irritiert.
„Natürlich!“ Frau Wagenknecht wirft mir einen unwirschen Blick zu. Sie verkrampft die Hände und sagt dringend: „Es darf nicht schneien.“
„Mein Gott, wäre es nicht besser, Ihr Mann bliebe zu Hause, wenn er dann doch nicht Skilaufen kann?!“
„Ach was“, sagt Frau Wagenknecht ungeduldig. „Er fährt morgen mit dem Auto. Mit dem A-u-t-o! Ist doch klar, daß in den Alpen Schnee liegt. Nur soll es hier nicht schneien!“ Anklagend schaut sie zum graugelben Himmel auf.
„Aber warum soll's hier denn nicht schneien“, frage ich arglos.
„Wir lieben Schnee“, schwärmt Frau Wagenknecht mit verklärtem Blick und schließt die Augen. Sie reißt sie so urplötzlich wieder auf, daß ich erschrecke.
„...aber nur im Urlaub!“, erklärt sie hart. Jedes Wort betont aussprechend, fügt sie noch hinzu: „...nur nicht hier!“ Ihre Augen glitzern nun böse.
„Aber die Kinder...“, wage ich einzuwerfen.
„Papperlapapp! ...die Kinder“, äfft sie mich nach. „Als wenn man heutzutage nicht andere Möglichkeiten hätte, die Kinder zufriedenzustellen“, meint sie aufgebracht.
Sie diszipliniert sich wieder und spricht nun ganz langsam und akzentuiert. „Wir leben in einem modernen Land und keiner, aber auch keiner kümmert sich darum, den Herbst mit diesen ekelhaften glitschigen Blättern und den Winter mit diesem dämlichen Schnee abzuschaffen.“
„Aber, liebe Frau Wagenknecht“, mir kommt da gerade so eine Idee, „wenn Sie Herbst und Winter gar nicht mögen, dann ziehen Sie doch ... vielleicht ... nach Süditalien. Da gibt's schon seit Jahrhunderten kaum noch Bäume und Blätter, und der Winter ist auch recht angenehm ohne Schnee und Eis!“ Erwartungsvoll schaue ich Frau Wagenknecht an.
Sie japst etwas nach Luft. Als es mit der Luft wieder geht, wirft sie mir einen vernichtenden Blick zu und sagt kalt: „Und wo soll da mein Mann arbeiten?“
„Aber wie wäre es dann mit...“, verzweifelt suche ich nach einem für Frau Wagenknecht akzeptableren Vorschlag, um sie beschwichtigen zu können.
„Schluß jetzt!“, beendet Frau Wagenknecht meine fieberhaften Überlegungen. „Wir bleiben hier wohnen! Nur mit dem Winter, das muß die Regierung noch in den Griff kriegen. Sonst wähle ich ab, das sage ich Ihnen..."
Frau Wagenknechts Stimme klingt drohend, zu allem entschlossen. Also wirklich, ich möchte jetzt nicht in der Haut der Regierung stecken...
(STOPpelfeld 12, Dezember 1993)
Drei vor zehn Von Ingrid Knebel
Sie standen da, in kleinen Gruppen, schwarz gekleidet und mit blassen Gesichtern. Einige hatten rotgeränderte Augen und hielten Taschentücher in der Hand. Kaum einer sprach. Neuankömmlinge wurden mit verhaltenem Nicken oder schweigender Umarmung begrüßt. Dann standen sie wieder still da mit ihren aufgewühlten Gesichtern und kummervollen Mienen.
Ein kleiner Mann durchschritt gemessen, doch seltsam zielstrebig, die Trauergesellschaft. Er ging bis zur Flügeltür der kleinen Kapelle, öffnete mit großer Ernsthaftigkeit erst die rechte Seite und dann die linke. Er ignorierte die fragende Geste einer Frau in tiefem Schwarz und tauchte in das Dämmerlicht des Raumes.
Zögernd setzte jetzt auch die Frau den Fuß auf die Schwelle, jedoch nicht, ohne sich mit einer halben Drehung des Kopfes vergewissert zu haben, daß man ihr folgte. Es war so, als hielte sie im letzten Moment eine unbestimmte Furcht davon ab, als erste einzutreten.
Ich setzte mich links am Mittelgang in die fünfte Reihe. Mir schien dieser Platz angemessen, war ich doch weder ein Verwandter des Verstorbenen, noch hatte ich in den letzten Jahrzehnten Kontakt zu ihm gehabt. Ich kannte ihn aus den unbeschwerten Tagen der Jugend, wo er mit uns Kindern immer zu scherzen bereit war. Ich hatte schon lange nicht mehr an ihn gedacht, und erst die Nachricht in der Zeitung brachte mir die Erinnerung zurück. Es war eine beeindruckende Todesanzeige gewesen. Doch ach, was nützte schon der schönste Nachruf, wenn man ihn selbst nicht mehr lesen konnte, dachte ich bedauernd. Ich lächelte ein wenig.
Gerade, als ich auf meine Armbanduhr blickte, hörte ich, wie leise knarrend die Tür zugeschoben wurde. Vor meinem geistigen Auge sah ich den kleinen Mann, wie er mit einer Bedeutsamkeit, die irgendwie rührend war, einen Türflügel nach dem anderen schloß. Er hatte diese einfache Tätigkeit zur Zeremonie erhoben.
Die aufdringlichen Geräusche der nahen Straße verstummten so abrupt, daß ich eine Leere um mich herum fühlte. Es war drei Minuten vor zehn.
Ich tauchte in ein Meer von Kindheitserinnerungen, merkte nicht einmal, wann meine Gedanken diesen Ort und den Verstorbenen verließen, um sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens zu machen.
Plötzlich schreckte ich auf, ohne mich auch nur einen Zentimeter bewegt zu haben. Es war ein Erschrecken tief in meinem Inneren. Irgendetwas war in diesem Raum passiert. Unwillkürlich versteifte sich mein Rücken. Ich war hellwach. Meine Augen tasteten verstohlen rechts und links die Umgebung ab. Nichts war zu sehen. Alle saßen still auf ihren Plätzen. Ein Gefühl von Unbehagen beschlich mich. Was war hier bloß los? Noch immer saßen alle bewegungslos und warteten. Irgendeine Bedrohung lag greifbar in der Luft.
Plötzlich bewegte der Mann zu meiner Linken ein wenig den Fuß. Es entstand ein häßlich kratzendes Geräusch, das sich überlaut in der durch Blumen und Moder geschwängerten Luft verhakte. Es war, als hätten alle in der Kapelle den Atem angehalten. Doch der Laut hatte eine sonderbare Konsequenz. Er wirkte wie der Auftakt zu einer akustischen Darbietung.
Plötzlich war der Raum erfüllt von vielerlei Geräuschen, hier ein Räuspern, dort ein Husten, Nasen wurden geputzt und Worte geflüstert. Etwas später setzte auch das Harmonium ein. Der Vorhang rechts bewegte sich leicht. Gottlob, der Pfarrer war in den Raum getreten, jetzt endlich konnte es beginnen. Erleichterung legte sich wie ein wärmendes Tuch über die Anwesenden. Ich schaute auf die Uhr. Es war genau zehn. Überrascht stellte ich fest, daß nur drei Minuten verstrichen waren.
Noch ehe der Pfarrer anfing zu sprechen, wußte ich mit einem Male, was geschehen war. Kein böser Geist hatte hier sein Unwesen getrieben. Ich war Teilhaber einer jener seltenen Momente in unserem modernen Leben gewesen, wo eine tiefe Stille wenige Minuten die Menschen in ihren Bann geschlagen hatte.
Und mir schien, als wären wir unvorbereitet gewesen und hätten es nicht als Wohltat empfunden, sondern mehr als Übel, und daß wir erst wieder lernen müßten, Stille als Mittel zur inneren Besinnung zu verstehen. (STOPpelfeld 15, Dezember 1995)
Tannenbaums Weihnacht
Von Ingrid Knebel
Es war der 6. Januar 1995. Heilige Drei Könige. Aber es hatte nichts mit diesem Tag zu tun. Ich fand einfach an jenem Tag, daß unser Tannenbaum weg mußte. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Noch bevor wir abends einer Einladung folgten, wrackte ich ihn ab.
Als wir wenige Stunden später ins Wohnzimmer unserer Freunde traten, dachte ich: Aha, hier steht ja noch der Tannenbaum. Und irgend etwas war an ihm, daß ich lachen mußte. Später, nach dem Essen, saß ich ihm in einiger Entfernung gegenüber, und wieder mußte ich lachen.
Er war alles andere als ein gestandener Tannenbaum. Der große selbstgebastelte Pappstern an der Spitze konnte nicht kaschieren, daß er nicht nur eine, nein zwei, ach du lieber Himmel, er schien sogar drei Spitzen zu haben. Zwischen den einzelnen Zweig-Etagen klafften große Zwischenräume, dazu schien es, als hätte er in der Mitte eine Taille, und die dann folgenden Zweige waren auf der einen Seite sehr viel ausladender als auf der anderen. Ich mußte schon wieder lachen. Und war es nicht ein bißchen so, als lachte er zurück?
Unsere Gastgeberin zündete die roten Kerzen an, die schlank und edel auf den sparsamen Zweigen steckten. Bald darauf fingen die Strohsterne an zu tanzen: sanft und selbstversunken. Ich sah es genau, der Baum war ganz gerührt und strahlte große Zufriedenheit aus, die er auf mich übertrug. Ich kuschelte mich in die Sofaecke. Ich hatte keine Zeit, mich am Gespräch zu beteiligen. Ich mußte sehen, was sich am Baum alles tat.
Er war gezeichnet von einem gnadenlosen Konkurrenzkampf, den er über Jahre hinweg im Garten unserer Gastgeber zwischen Laubbäumen und Sträuchern hatte ausfechten müssen. Nun, am Ende seines Lebens, wurde ihm eine Ehrung zuteil, die er offensichtlich genoß. Hin und wieder warf er mir einen Blick zu, um sich zu vergewissern, ob mein Interesse an ihm noch vorhanden war. Ich lachte ihm beruhigend zu.
Ich glaube, da bin ich mein ganzes Leben lang einem falschen Ideal nachgerannt. Zu Weihnachten ließ ich mir immer hunderte von Bäumen, aber vielleicht waren es auch nur Dutzende, gewiß jedoch acht bis zehn vorführen, um den herauszufinden, der das edelste Ebenmaß besaß, um nach dem Kauf immer noch zu denken: Wäre vielleicht nicht noch ein anderer perfekter gewesen?
Und jetzt, nach so vielen Jahren, wußte ich endlich, was mich immer wenige Tage nach Weihnachten so mißmutig machte. Mein Tannenbaum langweilte mich unendlich. Sein gläsernes Licht aus der Steckdose ließ keine Strohsterne tanzen und verzauberte keine Menschenseele.
Ich glaube, es kommen schwere Zeiten auf mich zu. Ich werde jetzt wohl fortan immer auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum-Individuum sein, um dann betrübt feststellen zu müssen, daß es in unseren Landen nur uniformierte Weihnachtsbäume zu kaufen gibt.
Innere Einkehr
Von Ingrid Knebel
Das ist wieder so ein Tag, dachte er und spürte, wie die Resignation vom Magen her seinen Körper überflutete. Er wußte aus Erfahrung, daß er sich selbst an solchen Tagen nichts recht machen konnte. Er hatte in vielen Jahren gelernt, damit umzugehen. Es deprimierte ihn nicht zusätzlich, daß er sich in diesem Zustand befand. Er nahm ihn an. Er war gefangen wie ein Vogel im Netz, während sein Kopf präzise und unerbittlich arbeitete.
Er durchforstete wahllos und ohne Schonung sein Leben. Und die Erkenntnisse stachen wie mit scharfen Messern in sein Fleisch und stachelten ihn gleichsam an, es immer toller zu treiben.
„Ich habe keine Freunde.“ Er beleuchtete diese Feststellung ausgiebig von allen Seiten. „Stürbe ich jetzt, niemand käme zu meiner Beerdigung“, sagte er sich. „Ich wäre auch im Tod so einsam wie im Leben.“
Dann dachte er sarkastisch: Ich bin so sensibel wie eine Frau. Doch halt, Ada würde sicherlich um ihn weinen. Ada war lieb und nett und hatte ihm immer geholfen, wenn er Rat brauchte. Aber warum rief sie gar nicht mehr an? Oder hatte sie sich doch das letzte Mal gemeldet und er hatte nicht zurückgerufen? Minutenlang sinnierte er und kam zu keinem Ergebnis. Ein Unbehagen machte sich breit und verstärkte seine Lustlosigkeit.
Aber Paul, das war ganz eindeutig, der hatte ihn im Stich gelassen. Seit dieser unglücklichen Sache vor ein paar Monaten war er in der Versenkung verschwunden. Paul käme bestimmt nicht zu seiner Beerdigung, obwohl Paul doch immer sein bester Freund gewesen war.
„Wenn ich jetzt tot umfiele, vielleicht würde Paul gar nicht erfahren, daß ich tot bin und könnte deshalb auch nicht zur Beerdigung kommen.“
Sollte er mal bei Paul vorbeischauen? Paul war Künstler. Er hatte die Dependance, die er an sein altes Haus angebaut hatte, in ein Atelier umgewandelt. Er wäre bestimmt zu Hause. Wieviel Schuld hatte er selbst an dem Zerwürfnis? Er versetzte sich in Pauls Lage und fing an, sich mit Pauls Augen zu sehen. Er wurde immer bedrückter. Die Messer stachen unbarmherzig in sein Fleisch, und niemand war da, der ihm erste Hilfe leisten konnte. Er wußte, er würde nicht zu Paul gehen.
Ihn störte auf einmal die Sonne. Und das Kreischen der Möwen schien ihm unerträglich.
Er mußte plötzlich an seinen Sohn denken, mit dem er immer am See spazieren gegangen war. Das war schon lange her. Da war sein Sohn noch klein gewesen. Einen Moment verweilte er in einer glücklichen Vergangenheit, bis ihm einfiel, daß sein Sohn sich schon lange nicht mehr gemeldet hatte. Plötzlich hatte er noch zusätzlich ein schales Gefühl im Magen, wenn er an die letzte Auseinandersetzung mit seinem Sohn dachte. Warum hatte er da so gebrüllt wie ein Stier und gesagt, daß er es nicht nötig hätte, sich das gefallen zu lassen? Er versuchte, sich zu erinnern, was der Grund für seinen Ausbruch gewesen war. Nichts Konkretes fiel ihm ein. Es deprimierte ihn sehr, daß er sich nur noch an seinen Wutausbruch erinnern konnte, aber nicht mehr an den Anlaß. Plötzlich kam ihm der Gedanke, daß sein Sohn bestimmt zu seiner Beerdigung kommen würde. Das stimmte ihn froh.
Natürlich, das Ordnungsamt würde solange forschen, bis es ihn fände, schon allein wegen der Übernahme der Kosten der Beerdigung, dachte er nüchtern und ertränkte rigoros den kleinen Lichtstrahl, der aus der Vergangenheit bis in seine trostlose Gegenwart gedrungen war.
Er mußte an die Mutter seines Sohnes denken, die noch immer seine Frau war und mit der er immer noch zusammenlebte. Seit zwei Monaten hielt sie sich geschäftlich im Ausland auf. Sie würde nicht rechtzeitig benachrichtigt werden können, weil niemand ihre momentane Adresse wüßte, außer ihm natürlich. Aber er wäre ja tot und könnte nichts mehr sagen. Bedauerte er, daß sie nicht zu seiner Beerdigung kommen könnte? Er war sich nicht ganz sicher, obwohl es eigentlich doch nett gewesen wäre. Hatten sie nicht früher viele lustige Stunden zusammen verlebt, bis die Gewohnheit zum Abgesang ihrer Ehe wurde?
Er wußte ganz genau, daß er heute nicht sterben würde. Es sei denn, es träte ein unvorhersehbarer Unglücksfall ein. Dieser letzte Gedanke erschreckte ihn ein wenig. Plötzlich fiel ihm seine Chefin, Frau Nagel, ein. Er und sie waren erklärte Feinde. Sie würde ihn vermissen. Und sie würde zu seiner Beerdigung kommen. Sie würde zur Beerdigung kommen müssen. Weil jeder Chef bei ihnen das tat, wenn einer der Untergebenen starb. Bei dem Gedanken empfand er Genugtuung. Frau Nagel würde allein an seinem Grab stehen, ein Pfarrer wäre auch nicht da, da er schon vor Jahren aus der Kirche ausgetreten war, und all die Gemeinheiten bereuen, die sie ihm in ihrer Gehässigkeit angetan hatte.
Er mochte Frau Nagel nicht. Er mochte sie nicht, weil sie seine Chefin geworden war, und man ihm keine Chance zum Aufrücken gegeben hatte.
Neulich hatte Frau Nagel ihn gegen den ekligen Schmidt, der ihr noch vorgeschaltet war, in Schutz genommen. War Frau Nagel vielleicht doch netter, als er immer glaubte? Er grübelte über Frau Nagel nach, und es fielen ihm noch mehrere kameradschaftliche Begebenheiten ein. „Eigentlich kann Frau Nagel gar nichts dafür, daß sie meine Chefin geworden ist“, dachte er unglücklich.
Ein Hund schnüffelte an seinem Hosenbein, und er schloß nicht aus, daß er das Bein heben könnte, um ihn zu besudeln.
Da fiel ihm auch sein Nachbar mit dem feisten Mops ein, der ihm immer, wenn er seiner ansichtig wurde, aus ästhetischen Gründen Unbehagen bereitete. Noch heute morgen war er beiden begegnet. Wer so aussah wie Herr und Hund, der mußte einfach eine unangenehme Vergangenheit und eine fragwürdige Zukunft haben. Außerdem, wer kaufte schon einen Hund, der einem selbst ähnlich sah?
Auf einmal war ihm unbehaglich zumute. Was hatte eigentlich dieser schreckliche junge Mann neulich noch zu ihm gesagt? Erst hatte dieser im Laden mit Getöse eine volle Flasche Milch fallen lassen, die ihn ziemlich bespritzte (Er hatte sich natürlich sehr darüber geärgert.), dann hatte ihn dieser Rotzlöffel auch noch „Bullenbeißer“ genannt. Nicht besonders bösartig. Einfach nur so.
Er hätte jetzt gerne einen Spiegel befragt, ob schon erste Anzeichen zu sehen waren, daß er vielleicht früher oder später auch wie ein Hund, beispielsweise wie ein Bullenbeißer, aussehen würde? Vielleicht konnte sein Nachbar gar nichts dazu, daß er wie ein Hund aussah.
Eigentlich war er ganz froh, keinen Spiegel zur Hand zu haben. Dann wäre ihm wieder eingefallen, daß er sich in den letzten Wochen einen ärgerlichen Bauch angegessen hatte. Doch auch ohne Spiegel war sein Bauch plötzlich in den Vordergrund gerückt. Er tastete ihn vorsichtig ab und wünschte, er könnte ihn wegzaubern. Plötzlich kam ihm der dicke Ziepert in den Sinn, der einen viel dickeren Bauch als er hatte, ohne daß ihn das im geringsten zu stören schien. Was gab es nur für Menschen! Manche waren so abstoßend fröhlich.
Erschreckt durch einen Radfahrer flog eine Taube flügelklatschend auf und ließ vor Schreck einen Kotflatschen auf seinen Jackenärmel fallen. Ihn erschreckte dieses Attentat überhaupt nicht. Auch machte er keinerlei Anstalten, den Fleck zu beseitigen. Er nickte resigniert und sagte laut: „Das geschieht mir recht!“
Er sah in diesem Akt eine Strafe für all die Schuld, die er in letzter Zeit auf sich geladen hatte. Er wollte sühnen, und da kam ihm die Taube gerade recht.
Ein unvermittelter Windstoß klatschte seinen Mantel an den Rücken. An ihm vorbei flog ein Hut. Hinter sich hörte er einen entsetzten Aufschrei. Er drehte sich um und sah, wie die Besitzerin des Hutes versuchte zu laufen. Spontan setzte er sich in Bewegung, griff zweimal daneben, weil ein neckischer Wind den Hut in eine andere Richtung scheuchte, dann hatte er ihn endgültig eingefangen.
Er starrte fasziniert auf das Teil, das er in der Hand hielt. Es war ein schmuckloser Hut, der fast die Form eines Stahlhelmes hatte. Dazu hatte er auch noch fast die Farbe eines Stahlhelmes. Daß er aus Filz war, sah man eigentlich nur an dem speckigen Rand unten, der dunkel und glasig glänzte.
Inzwischen hatte die Hutbesitzerin ihn erreicht und streckte schweratmend die Hand nach ihrem Hut aus. Es war eine sehr alte Frau. Das Leben hatte tiefe Furchen in ihr Gesicht gegraben, aber sie lachte so glücklich, daß er gerührt war. Sie liebkoste fast ihren Hut und hielt ihn an sich gepreßt, als wäre es ihr Hund, den sie tagelang nicht gesehen hatte oder ein vermißtes und wieder aufgetauchtes Kind.
„Sie müssen das verstehen“, sagte sie mit erstaunlich fester Stimme. „Dies ist mein erster Hut, und er hat mich die vielen Stationen meines Lebens begleitet. Früher war er der letzte Schrei, und ich war natürlich jung und hübsch.“
Sie schien Angst zu haben, ihn aufzusetzen. Sie wollte ihn einfach nicht ein zweites Mal einem vielleicht nicht so gnädigen Schicksal aussetzen.
„Dieser Hut war überall in meinem Leben dabei. Er steckt voller schöner Erinnerungen. Ich glaube“, sagte sie etwas schelmisch, „wenn ich ihn verliere, dann muß ich sterben.“
Er hätte ihr gerne gesagt, daß er auf jeden Fall zu ihrer Beerdigung kommen würde. Doch er beugte sich nur zu ihr nieder und sagte: „...auf daß Ihr Hut nie verloren gehen möge und Sie ewiglich leben.“
Die alte Frau lachte so fröhlich, daß er fröhlich mitlachen mußte.
Dann machte er sich schnell auf den Weg. Er hatte noch viel zu erledigen. Seinen Sohn, Ada und Paul mußte er anrufen. Dem Nachbarn mit dem fetten Mops könnte er endlich danken, daß er ihm jeden Morgen die Zeitung vor die Türe legte. Frau Nagel hatte übermorgen Geburtstag. Er machte sich einen Knoten ins Taschentuch, damit er es nicht vergessen würde, ihr ein paar Tulpen, die ihre Lieblingsblumen waren, mitzubringen.
Und in ein paar Tagen kam endlich, nach so langer Abwesenheit, seine Frau wieder. Er mußte noch Sekt und Kaviar besorgen und ein paar Rosen. Sein Sohn würde dann auch zur Begrüßung kommen und die neue Freundin, die am Telefon eine so wundervolle Stimme hatte, vorstellen.
Und dann mußte er auch noch den Taubendreck vom Ärmel bürsten. 1992
Bekenntnisse der Ingrid K.
Ich liebe ihn.
Sicher, wenn ich ihn ganz kritisch
betrachte, finde ich natürlich
so manches Haar in der Suppe.
Auch ist er nicht unbedingt
selbstlos und irgendwie sogar
ein bißchen berechnend.
Doch seine Vorzüge genieße
ich uneingeschränkt.
Er ist immer für mich da,
besonders, wenn ich frierend
unterwegs bin. Er holt mich
dann ab und bringt mich fast
bis nach Hause.
Sicherlich, es gibt andere,
die sich bedeutend individueller
bewegen und die nicht so
verdammt linientreu sind.
Doch wenn viele Partner
sich schon gemütlich vor
dem Fernseher räkeln, dann
ist er noch liebenswert aktiv.
Mittlerweile kenne ich seine
Psyche und finde ihn sehr
berechenbar. Deshalb mag ich ihn
mit allen seinen kleinen Schwächen.
ICH LIEBE IHN –
den Öffentlichen Personen-
Nah-Verkehr.
 |
Glosse von Ingrid Knebel
Erst wenige Tage war das Gesetz zum Schutz der Rabenvögel alt, als sich Jäger, völlig verängstigt, zusammenrotteten und die Sturmglocke läuteten, denn es galt, einer unübersehbaren Naturkatastrophe Herr zu werden: Elstern waren im Revier, die mordend und schändend die Gegend unsicher machen würden. Und es gab in diesen EG-Landen kein Gesetz mehr, das dem fürchterlichen Treiben Einhalt gebieten könnte.
Die Jäger fühlten sich matt und wehrlos, fast so, als hätte man ihnen Liebesperlen ins Gewehr gefüllt. In erschütternden Referaten schilderten sie, wie dieses brutale Gesetz das Leben eines Waidmannes bis in seine Grundfesten erschüttern würde.
Bei soviel jägerlichem Leid mußte sich doch jemand erbarmen. Und siehe da, es nahte Diana, die Göttin der Jagd, in Gestalt des nordrhein-westfälischen Umweltministers. Ihn dauerte die Larmoyanz der Jäger, und so versprach er furchtlos, einzugreifen – trotz all der bösen selbsternannten Natur- und Umweltschützer. Er hob begütigend seine Hände und erteilte den erwartungsträchtigen Jagdgesellen schon mal vorab drei Tage Ausnahmegenehmigung.
So eilten beglückt all die Heger flugs ins Revier und erledigten ihre Pflicht. Hier und da ein kleiner Knall, und dann trudelte ein nutzloses Elsternleben gen Boden.
Na, bitte, es klappte ja noch! Denn das weiß schließlich schon der kleine Jäger: Nur eine tote Elster ist auch eine gute Elster. (1987, STOPpelfeld Nr. 2)
Wider die Natur
Von Ingrid Knebel
Menschen ohne Wurzeln
sind wie
Menschen mit Zweitwohnungen.
Sie sind immer auf dem Sprung.
Braucht man sie hier,
dann sind sie gerade dort.
Und umgekehrt.
Sie sind verfügbar.
Oder auch nicht.
Ihr Leben ist geprägt
vom Zwang zur Wahl.
Menschen ohne Wurzeln
sind wie
Schnittblumen in der Vase.
Sie bereichern ihr Umfeld.
Zeitweilig.
Kurzzeitig.
Menschen ohne Wurzeln
sind wie
vergessene Schnittblumen
in der Zweitwohnung.
Einsam und vergänglich.
Und doch. Irgendwann einmal
finden einige den
unscheinbaren Weg
der Erkenntnis.
Vielleicht liegt er in
der Mitte zweier Sehnsüchte.
Und dort ereilt sie die Natur.
Ohne ihr Zutun
werden sie dann Wurzeln
schlagen.
STOPpelfeld 12, Dezember 1993
K r e i s l a u f
Von Ingrid Knebel
Es gibt Tage,
da hat man alles vergessen.
Da steht man der Bewältigung
der Gefühle und der Welt
machtlos gegenüber.
Ohne Überzeugung sind dann
die Erkenntnisse von gestern.
Und alles fängt wieder
von vorn an.
Es gibt Tage,
da öffnet man die Augen
und ist glücklich
und öffnet die Jalousie,
und es regnet.
Und nichts vermag dieses
Gefühl zu verdrängen.
Und erst im Alltag des Tages
geht es dann
unmerklich verloren.
Es gibt Tage,
da wacht man schon mißmutig auf
und horcht nach innen
und baut an Barrieren
gegen Sonne und Menschen.
Und erst der freundliche
Augen-Blick eines Fremden
reißt alles nieder.
Und es ist dann so wie immer,
weder himmelhoch
noch abgrundtief.
(1999)
Über den eigenen Schatten springen
Von Ingrid Knebel
Eigentlich fing alles mit Horst Stern an. In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts rüttelte er die Menschen mit seinen Fernseh-Sendungen „Sterns Stunde“ auf, in denen er auf schnörkellose Weise Missstände aufzeigte, die durch gedankenlosen Umgang mit der Natur entstanden waren.
Damals hörte man, dass sich Naturschutzvereine gebildet hatten, doch wo diese waren, das war nicht ersichtlich. Der Wunsch, in so einen Verein einzutreten, war plötzlich da, doch es dauerte noch bis 1981, bis ich endlich in Monheim einen Hinweis auf eine derartige Gruppe fand. Ich las im damaligen „Stadtkurier“ von einer Naturschützerin, die sich bei einem Landwirt für die Überlassung eines Gerätes zum Mähen einer Wiese bedankte.
Endlich hatte ich eine Adresse gefunden und rief, ich glaube, stehenden Fußes dort an. Zwei Tage darauf erschien ein junger Mann, der Anmeldeformulare mitbrachte. Innerhalb von wenigen Minuten waren mein Mann in den DBV, den Deutschen Bund für Vogelschutz, der heute NABU heißt, und ich in den RBN, den Rheinisch-Bergischen Naturschutzverein, eingetreten.
Rückblickend muss ich sagen, dass auf diesen Schritt über zwanzig zwar arbeitsame, doch überaus interessante Jahre folgten, die ich niemals missen möchte. Wie in jeder menschlichen Gemeinschaft, gab es Höhen und Tiefen, doch immer spielten Natur und Umwelt die erste Geige.
Ich kann mich noch gut an meine erste „Aktion“ 1982 erinnern. Ich hatte erfahren, dass auf dem Platz vor der Humboldtschule in Baumberg im Zuge des Baus eines Bürgerhauses für einen dort geplanten Parkplatz zwei Birken gefällt werden sollten. Es verstörte einen geradezu, dass diese schönen Bäume mit ihrem zierlichen Laub, das immer so anmutig im Wind wehte, für so einen Zweck weg kommen sollten.
Man müsste…, dachte ich, man müsste sich da unten hinstellen und Unterschriften sammeln. Doch so ein Gedanke war zu der damaligen Zeit geradezu abenteuerlich. Nun hatte ich kurz zuvor zwei Druckapparate, die mein früherer Arbeitgeber nicht mehr brauchte, käuflich erworben. Vielleicht sollte ich zwei Tafeln bedrucken, um Leute aufmerksam zu machen?
Wenn man etwas von Druckapparaten hört, kann man sich in der heutigen computergesteuerten Zeit nicht vorstellen, was für vorsintflutliche Dinger das waren. Man hatte ein großes Brett mit einer arretierbaren Schiene und musste darauf jeden Buchstaben, den man auf einem Stempelkissen mit Farbe getränkt hatte, einzeln drucken. Das war sehr nervenaufreibend. Es war schon eine Kunst, das Stempelkissen so anzufeuchten, dass das Ergebnis hinterher schön akzentuiert auf der Pappe stand. Später, bei längeren Texten für Ausstellungstafeln, saß einem immer die Angst im Nacken, sich zu verschreiben. Da gab’s dann nichts zu berichtigen: Man musste alles neu schreiben.
Mein Mann lag zu dieser Zeit mit einer Lungenentzündung im Bett. Diesmal dachte ich es nicht nur, sondern sagte zu ihm: „Einer müsste sich da unten hinstellen!“ Mein Mann, der auch sehr erbost über die Pläne war, sagte: „Ja, das wäre das einzig Richtige!“ Er ahnte nicht, dass er mir damit die letzten Hemmungen nahm. Jetzt wusste ich, dass niemand sonst außer mir das machen würde.
Ich schrieb mit meinem Druckapparat einen Protest groß und übersichtlich auf zwei grüne Tafeln, machte rechts und links Kordeln dran und bereitete eine Unterschriftenliste vor. Etwas überrascht, doch auch erfreut, war mein Mann, als ich mit meinen Utensilien unterm Arm verkündete: „So, ich geh jetzt Unterschriften sammeln.“
Man kann sich heutzutage nicht mehr vorstellen, wie mulmig einem damals zumute war. Mein Mund war trocken. Ich befestigte die Tafeln an den Birken und stellte mich in die Einflugschneise der Kirchgänger. Einerseits, dass man mit einem Anliegen auf die Straße ging, andererseits, dass man wildfremde Leute ansprach, das war die erste Mutprobe im Naturschutz, der ich mich stellte. Zwei Stunden morgens, zwei Stunden nachmittags stand ich da. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Nur ein Mann sagte: „Ja, wenn die Stadt das für richtig hält, dann wird das wohl schon in Ordnung sein.“ und lehnte eine Unterschrift ab.
„Du musst“, sagte Edith Bader, die bereits über umfassende Kenntnisse der städtischen Verwaltungsarbeit verfügte, „einen Protest in der Fragestunde der nächsten Ratssitzung vorbringen.“ Ich fiel, gelinde gesagt, fast in Ohnmacht. „Ich komme mit, doch ob ich was sage, weiß ich nicht“, behielt ich mir vor. Damals tagte der Rat noch im Saal der Volkshochschule. Nachdem ich der geballten männlichen Dominanz der Ratsmitglieder ansichtig wurde, war für mich klar, dass ich hier nichts sagen würde. In diesem Bewusstsein konnte ich mich endlich entspannt zurücklehnen. Doch was war das? Ich wurde immer erstaunter, was für alltägliche, teilweise mir unwichtig erscheinende Punkte da in aller Ausführlichkeit behandelt wurden. Plötzlich regten sich so lästige Gedanken in mir. Du bist ein Feigling, wenn du jetzt nichts sagst. Hier geht es um das Überleben von zwei Bäumen. Und tatsächlich zeigte ich nach der Frage, ob Bürger etwas sagen wollten, auf. Ich verlas meinen vorbereiteten aufrüttelnden Text mit zittriger Stimme und überlaut klopfendem Herz. Ich weiß nur noch, dass ein Moment Stille herrschte, als ich geendet hatte, doch was danach gesagt wurde, weiß ich nicht mehr. Die Unterschriften und einen Plan, wie der Parkplatz aus meiner Sicht besser angelegt werden könnte, reichte ich bei der Bürgermeisterin ein. Das Ergebnis war erfreulich. Das Tiefbauamt wurde beauftragt, einen neuen Parkplatz zu konzipieren unter Beibehaltung der beiden Birken. „Sie haben mir Arbeit gemacht“, hat der Leiter des Tiefbauamtes mir später oft vorgeworfen. Doch die beiden Birken stehen heute noch und einige Anwohner haben sich sehr darüber gefreut.
Ja, so fing alles an. Danach kamen viele Aktionen, die ich mit Edith Bader zusammen meisterte. Zur damaligen Zeit waren die Städte Monheim und Langenfeld zu einer Naturschutzgruppe zusammengefasst. Es stellte sich jedoch immer mehr heraus, dass beide Städte genug eigene Probleme hatten, so trennten sie sich, und Monheim gründete am 9. April 1986 selbst eine Ortsgruppe. Der erste Zusammenschluss von Naturschützern hatte sich 1978 gebildet und umfasste anfangs die Städte Haan, Hilden, Langenfeld und Monheim.
Mit der Trennung von Langenfeld war auch verbunden, dass Monheim eine eigene Publikation herausgeben wollte. Ich wurde gefragt, ob ich das machen könnte. Etwas zögerlich sagte ich ja und wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Arbeit an dem Heft „STOPpelfeld“ mich zum begeisterten Workoholic machen würde. Elf Jahre habe ich das Heft herausgegeben.
Wie eine Bombe platzte 1986 die Mitteilung in unsere Gruppe, dass Haus Bürgel zu einem Domizil für Golfer werden sollte. Ein Investor aus dem Bergischen Land stand schon auf der Matte. Ich habe unzählige Briefe an Behörden und am Erhalt der Landschaft Interessierte geschrieben, um das Unheil von der Urdenbacher Kämpe abzuwenden. Unsere Gruppe hat Unterschriften gesammelt, doch Edith Bader und ich hatten den längsten Atem. Wir standen monatelang bei jedwedem Wetter, schwitzend, frierend oder nass, und hatten schließlich etwa eintausend Unterschriften zusammen. Eine junge Frau weigerte sich damals kategorisch mit dem Hinweis: „Nein, nein, das letzte Mal, als ich was unterschrieben habe, da war ich dann im Buchclub!“ Damals war alles nicht so einfach. Heutzutage ist man pfiffiger, da werden Listen in Geschäften ausgelegt, und die Unterschriften sammeln sich quasi von selbst.
Das Problem an der Sache war, dass der Eigentümer das unter Denkmalschutz stehende Haus Bürgel völlig verkommen ließ und eine Sanierung unbedingt nötig war. Durch unsere in alle möglichen vorgeschalteten Behörden gestreuten Proteste, verzögerte sich die endgültige Zustimmung zu dem Vorhaben enorm. Und plötzlich war Licht am Horizont: Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung wollte das durch Rubbellose eingenommene Geld zur Sanierung von Haus Bürgel aufwenden. Dass Haus Bürgel zum Fass ohne Boden wurde und der Abschluss der Sanierung erst im Jahr 2006 feierlich begangen werden konnte…, aber das ist eine andere lange Geschichte. Doch zwei erfreuliche Ergebnisse, die auch mit unserer Verhinderungstaktik zusammenhingen, sind noch erwähnenswert: Reuters mit der Kaltblutzucht durften auf Haus Bürgel bleiben und die Biologische Station wurde 1991 gegründet. Monheimer Naturschützer waren entscheidend am Entstehen beteiligt und sechs von ihnen waren im Trägerverein.
Mitte 1989 erfuhr ich über Edith Bader, dass ich für das Heft STOPpelfeld den Journalistenpreis der Deutschen Umweltstiftung Germersheim erhalten und in einem festlichen Akt geehrt werden sollte. Ehrlich gesagt war ich zu jenem Zeitpunkt mehr entsetzt als erfreut und dachte nur: Was kommt da auf dich zu? Bist du dem überhaupt gewachsen?
Doch ich hatte von Juli bis Anfang Dezember Zeit, mich abzureagieren und an den Zustand zu gewöhnen.
In den Zeitungen war zu lesen, dass die „Hausfrau mit der spitzen Feder“ einen Preis bekommen sollte. Auch der WDR, Radio Bergisch Land, bat um ein Interview. Schon mit einem ganz komischen Gefühl sagte ich nach einigem Zögern zu. Die Angst rumzustottern nagte an mir. Der damalige Moderator Hajo Jahn stellte mir Fragen. Zu Anfang ging es ganz gut. Und einmal, als er merkte, dass ich Schwierigkeiten hatte, den Satz zu Ende zu bringen, stellte er ganz schnell eine neue Frage, so dass mein Mangel nicht auffiel. Doch etwas später kam dann eine Frage, deren Beantwortung mir im Nachhinein keinen Schwierigkeitsgrad zu enthalten schien, doch mir wollte partout kein passables Satzende einfallen. Während ich hoffnungslos um die richtige Wortwahl rang, erkannte ich gleichzeitig, dass diesmal von Hajo Jahn keine Hilfe zu erwarten war. Ich sah ganz deutlich an seinem Gesichtsausdruck: Wenn die einen Journalistenpreis kriegt, dann soll sie auch sehen, wie sie ihre Sätze zu Ende bringt. Irgendwann war er dann tatsächlich zu Ende gesprochen, der Satz. Der Journalist, der mich zum Sender gefahren hatte, brachte mich auch nach Hause. Ich saß wie ein Häufchen Unglück im Wagen. Doch er sagte zu mir: „Na, das hat doch gut geklappt!“ Ich war für keinen unberechtigten Trost zu haben und fing an über mein Unvermögen zu sprechen. Erst später ging mir auf, dass der bestimmt bei den anderen Journalisten gesessen und Kaffe getrunken hatte und deshalb gar nichts wusste.
Zuhause musste mich mein Mann erst mal wieder aufbauen. Ein guter Freund rief an und war untröstlich, dass er den Sender im Radio nicht gefunden hatte, um an meiner „großen“ Stunde teilnehmen zu können. Ich ließ mir diesmal nichts anmerken und war insgeheim froh, dass er nichts mitgekriegt hatte. Danach habe ich mich am Schopf aus dem Sumpf gezogen, weil mir plötzlich ein Ausspruch der Theaterleute einfiel: Wenn die Generalprobe nicht klappt, dann ist die Premiere um so besser. Daran habe ich mich geklammert, denn abends wurde der Journalistenpreis an mich verliehen.
Eine Menge Leute sollten Reden halten: der Staatssekretär, dann Prof. Dr. Udo-Ernst Simonis, dessen Name erst so richtig bekannt wurde, als einige Jahre später seine Frau, die Heide, Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein wurde. Auch unsere Bürgermeisterin, Ingeborg Friebe, die später über Monheim hinaus als Landtagspräsidentin große Bekanntheit erfuhr, würde eine Rede halten. Edith Bader, die mit ihrem Mann die Organisation für die Feier übernommen hatte, sagte vorher: „Wir stellen die Stühle nicht so eng zusammen, dann sieht das Publikum nach mehr aus.“ Letztlich wäre das nicht nötig gewesen, denn überraschenderweise waren doch so etwa einhundert Leute gekommen.
Frau Friebe, die am gleichen Tag einen Zahn gezogen bekommen hatte, machte mich darauf aufmerksam, dass ihre Rede sehr kritisch sei. Nun gut, dachte ich, das geschieht dir recht, du bist ja im STOPpelfeld auch immer kritisch mit der Politik umgegangen.
Frau Friebe trat nach dem Staatssekretär ans Podium und holte aus ihrer Handtasche das Manuskript. Erwartungsvolle Stille herrschte im Saal. Frau Friebe blätterte, schaute in der Tasche nach, blätterte wieder, drehte die Seiten um, dann sagte sie hilflos vor versammelter Mannschaft: „Mir fehlt die erste Seite!“ Das Gelächter im Saal war groß. Ich habe alles nicht so mitgekriegt, was sie dann gesagt hat, denn ich war voll konzentriert auf meinen Redebeitrag, der dann folgen sollte. Später erzählten mir Freunde, dass es Frau Friebe gar nicht so leicht gefallen sei, eigene Eingangsworte zu finden, um dann im Text weiter machen zu können.
Dass so einer Profipolitikerin so etwas passierte, das hat mich total ruhig gemacht. Ich wusste, ich hatte ein Konzept in der Handtasche und eins in der Hosentasche. Mir, dem absoluten Laien, würde so etwas nicht passieren.
Für meine Rede hatte mir Edith Bader einen Tipp gegeben: „Wir sind nicht so groß, sieh zu, dass du das Mikrophon etwas herunterziehst.“ Und das tat ich dann auch als erstes, als ich am Rednerpult stand. Hinterher musste ich fürchterlich lachen, als mir erzählt wurde, gerade diese Geste hätte einen total professionellen Eindruck gemacht.
Wie recht die Theaterleute haben, konnte ich nach der Feier bestätigen. Mit mir hatte alles gut geklappt und mit den anderen sowieso, so dass dieser Abend wirklich zu einem Höhepunkt in meinem Leben wurde.
Den Namen STOPpelfeld für unser Heft hatte ich gewählt, weil ich aufrütteln wollte, damit unsere Erde nicht zum abgeernteten Stoppelfeld wird. „Eine schreckliche Vision, die nur dann Vision bleibt, wenn wir alle endlich aufwachen!“, stand auf jeder Titelseite. Es war schon ein enormer Arbeitsaufwand, mit den damaligen Mitteln ein anschauliches Heft zu erschaffen. Durchschnittlich zwei Monate habe ich an der Herstellung gearbeitet. Mit jedem Heft hatte ich ein bisschen mehr Erfahrung, was Journalismus und Design anging, gesammelt. Mein Anspruch war ein attraktives Heft, das sauber gearbeitet war und durch Illustrationen und interessante Überschriften zum Lesen reizen sollte. Artikel über örtliche Politik und Umwelt, Tipps, Rezepte, Gedanken, Gedichte und Glossen konnte man dort finden. Erst im Jahre 2002 habe ich mir einen Computer angeschafft und danach immer gedacht, wie leicht wäre die Arbeit gewesen, wenn du früher schon so ein Ding gehabt hättest. Doch damals war alles Handarbeit. Um größere Überschriften zu bekommen, habe ich sie mit Druckapparat oder Schablone, von denen ich im Laufe der Jahre ein ganzes Sortiment gekauft hatte, geschrieben. Um das Heft lebendig zu machen, habe ich eigentlich immer und überall Illustrationen gesammelt, die ich vielleicht einmal gebrauchen könnte. Doch jedes aufgeklebte Teil hinterließ beim Kopieren an einer Seite immer einen Schatten. Also musste viel mit Tippex nachgearbeitet werden. Es waren viele Details, die man ausführen musste, ehe so ein Heft druckreif war.
Einmal habe ich auf der letzten Seite hinter Redaktion und meinen Namen noch „M.f.a.“ gesetzt. Ich war ziemlich enttäuscht, dass mich niemand gefragt hat, was dieses Kürzel bedeutete. Alle dachten sicherlich, das sei etwas speziell Journalistisches. Ich hatte mir einen Scherz erlaubt, denn es hieß: Mädchen für alles.
Doch als ich dann schließlich 1997 wenigstens eine Computer-Schreibmaschine, leider nicht zu vergleichen mit einem Computer, mir zulegte, die mir die Arbeit erleichterte, da habe ich aufgehört mit dem STOPpelfeld, weil mich das generelle Desinteresse an Umwelt fertig machte. Eins war jedoch schön für mich, dass viele meinen Schritt sehr bedauerten und das Heft vermissten.
Die Herausgabe des STOPpelfeldes hatte für den Monheimer Naturschutz einen großen Vorteil: Es wurde vom Stadtdirektor als Presseorgan anerkannt. Dadurch bekamen wir Ausschuss- und Ratsunterlagen. Der Stadtdirektor, der nach eigenem Bekunden nichts von Natur verstand, war jedoch nie abgeneigt, sich unsere Ansicht anzuhören. Selbst wenn er und die Politik anderer Meinung waren, die Zusammenarbeit war von gegenseitiger Achtung geprägt.
Edith Bader und ich haben viele Ausschuss- und Ratssitzungen besucht, denn nur so erfuhr man rechtzeitig von Plänen der Verwaltung, die die Umwelt tangierten.
1992 versuchten wir beide die japanischen Kirschbäume auf der Poststraße zu retten, die im Zuge einer Straßensanierung gefällt werden sollten. Früh morgens legten wir den Bäumen Totenhemden mit Aufschriften an, die ich in stundenlanger Arbeit bis tief in die Nacht angefertigt hatte. Einerseits wollten wir die Anwohner anspornen, sich für ihre Bäume einzusetzen, andererseits strebten wir doch noch ein Umdenken bei der Stadt an. Doch gegen die Auffassung der Verwaltung: „Wenn wir die Straße schon umbauen, dann sollen wir auch mit neuen Bäumen anfangen.“, war kein Kraut gewachsen. Heute stehen dort Säulenebereschen, die in keiner Weise an das vorherige besondere Flair das Straße erinnern, die sich im Frühjahr immer bezaubernd mit einem Meer von rosa Blüten schmückte.
So gingen die Jahre dahin mit sehr viel ehrenamtlicher Arbeit für den Naturschutz. Einige Leute verließen unsere Gruppe, andere kamen hinzu. Unsere Gruppe erstellte ein Fahrradkonzept, das zwar große Anerkennung im Rat erhielt, doch wenig an Umsetzung erfuhr.
Mit dem Schüler Alexander Schumacher war ich wochenlang mit einer Untersuchung der Bushaltestellen im Stadtgebiet von Monheim am Rhein beschäftigt. Alexander konnte schon sehr versiert mit den Computer umgehen, was ich damals bewunderte. Als ich dann später auch einen Computer hatte, holte ich alles auf. Wir konnten unseren, über 80 Seiten starken Bericht mit Bilddokumentation und Bestandserfassung sowie Bewertung und Verbesserungsvorschlägen im Oktober 1995 dem Rat vorlegen, der sich aber nicht für zuständig hielt und die Arbeit an die Bahnen der Stadt Monheim weiterleitete. Monatelang dachten wir, dass unsere Arbeit für die Katz’ gewesen sei, doch plötzlich wurde überall an den Haltestellen gearbeitet. Wir hatten die Initialzündung für besseres Aussehen und Zweckmäßigkeit gegeben.
Um die Sauberkeit an Haltestellen zu verbessern, stellte ich im Januar 2000 einen Antrag im Planungsausschuss, an stark frequentierten Haltestellen sukzessive Abfallbehälter mit Zigarettenkippeneinsätzen zu installieren. Dem Antrag wurde zugestimmt und in Zusammenarbeit mit den Bahnen der Stadt Monheim wurden 30 neue Abfallbehälter aufgehängt, die den pfiffigen Slogan trugen: Bitte keine Kippen schnippen!
Trotz der vielen Aktivitäten im Naturschutz durfte natürlich das Familiäre nicht zu kurz kommen. Es ist eine Frage der Einteilung, dann kann man seinen Verpflichtungen dem Mann, dem Kind und den Müttern gegenüber auch noch nachkommen. Obwohl der Naturschutz den Hauptteil meiner Freizeit beanspruchte, war und ist das Fotografieren ebenfalls eine Leidenschaft von mir. Nachdem sich in Schränken und Schubladen die Fotos häuften und sie irgendwie ein unbefriedigendes Dasein führten, kam mir 1998 plötzlich die Idee, eine Ausstellung zu machen. Das war wieder Neuland, das ich betreten wollte, doch dieses Mal hatte ich das starke Gefühl: Das kannst du. Mit dem für andere ganz unverständlichen Thema „Asphalt-Impressionen“ stellte ich in der damaligen Monheimer Stadt-Sparkasse 45 Fotos aus. Naturschützer kämpfen eigentlich gegen die Asphaltierung der Landschaft. Nunja, das ist schon richtig, doch ich hatte genauer hingesehen und den Asphalt im Detail als Fotomotiv entdeckt. Da war abfließendes Hochwasser, das auf dem Urdenbacher Weg in edlen Wellen über die Straße floss, da war eine dicke Schraube, die beim Planieren einer neuen Straßendecke dekorativ in den Asphalt gedrückt war, da hatten die Reifen von Lastkraftwagen die phantastischsten Spuren hinterlassen, da waren Zeichen und Signale von Verkehrsplanern zu sehen.
Im Jahre 1999 beteiligte ich mich in der Volkshochschule mit 10 Fotos bei der Aktion „Freizeitkünstler stellen aus“. Ich hatte vom Shellgelände Bilder ausgewählt, die den verrottenden Charme alter Industrieanlagen ausströmten und die von wild wachsender Natur wieder besiedelt wurden.
Meine bisher umfangreichste Ausstellung war 2000 im Rathaus mit dem Titel „Ich liebe dich“. Dort präsentierte ich 89 Fotos, die ausschließlich in der unmittelbaren Umgebung von Monheim gemacht wurden und Pflanzen und Insekten im Makrobereich sowie Landschaften im Wechselspiel von Licht und Wolken zeigten. Viele Leute waren begeistert und zeigten sich völlig überrascht, welche Artenvielfalt es hier im Gebiet gibt.
Dagegen war das Objekt meiner Ausstellung ein Jahr später auch im Monheimer Rathaus ein technisches. Mit „Das Monheimer Jahrhundertbauwerk“ dokumentierte ich mit 60 Bildern viele Phasen beim Bau der Deichrückverlegung im Rheinbogen von Monheim.
Besondere Freude bereitete mir 2002 die Teilnahme an der Ausstellung im Langenfelder KunZe, dem KundenZentrum des Verbandswasserwerkes. Unter dem Titel „Zwischen Himmel und Erde ist Wasser“ wurde das nasse Element zum Kunstobjekt. Ich nahm mit 20 Fotos teil und zeigte, welche künstlerischen Formen Wasser annehmen kann.
Für Fotografen ist Haus Bürgel immer ein Ort von Interesse. Beim Tag des Offenen Denkmals im September 2006 konnte ich in einer Ausstellung fast 50 Bilder zeigen, die „20 Jahre Haus Bürgel“ dokumentieren und die zurzeit noch zu sehen sind.
Am Jahresanfang 2002 stellte jemand an mich eine Frage. Es war der Redaktionsleiter der Rheinischen Post Langenfeld-Monheim. Er fragte, ob ich Lust hätte, für die Zeitung zu schreiben. Hier konnte ich voller Lust zusagen, denn das war genau das, was ich mir immer gewünscht habe. So bin ich schließlich erst als älterer Mensch dort gelandet, wo eigentlich ein Teil meiner Berufung liegt.
Eine Sache hat sich allerdings in meinem Leben noch nicht erfüllt. Vor nahezu zehn Jahren habe ich ein Buch geschrieben. Obwohl es von einem ungewöhnlichen Kind handelt, ist es doch kein Kinderbuch geworden. Allerdings habe ich es noch nie systematisch angeboten, wohl deshalb, weil ich mir ohne Beziehung kaum eine Chance ausrechne. Gleichwohl habe ich immer das Gefühl, einmal wird ein Verleger vom Himmel fallen, der es dann veröffentlicht, doch hoffentlich nicht erst, wenn ich schon
da oben bin…
Monheim am Rhein, im April 2007
Die Freiheit, die zum
Himmel stinkt
Von Ingrid Knebel
Sie geben ihnen
Windschnittigkeit,
Power unter der Haube
und das Image der Freiheit.
Sie statten sie mit
Komfort und Kokolores aus.
Sie werben für sie mit
nackten Frauen, Machos
und Familien.
Sie –
die teuflisch-tüchtigen
Automobilhersteller.
Sie werden frisiert
und gewienert.
Sie stehen vor der Tür
oder in kleinen,
extra für sie gebauten
Häusern oder in Katakomben.
Sie fungieren als
Liebeslaube oder Totenfähre.
Sie bringen Hochzeiter
zur Kirche oder Tod und
Verderben.
Sie –
die teuflisch-präsenten
Autos.
Sie lassen sie
heulen und quietschen bei
gepflegter Sofabequemlichkeit.
Sie lassen Fußgänger sich
Pfützenspritzer vom Mantel
wischen bei Mozartklängen.
Sie rümpfen die Nase über die,
die frierend am Bus warten:
Sie besitzen
die Freiheit der Wegwahl.
Sie blasen bei voller Dröhnung
zur Hatz auf Fahrbahnüberquerer.
Sie lassen Reifenabrieb
und Staub aufwirbeln.
Sie lassen durch Auspüffe
Allergien, Ozonlöcher
und Pseudokrupp
entstehen.
Sie –
die unerbittlichen
Autofahrer.